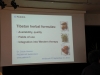Hanf
Der Hanf aus der Familie der Hanfgewächse ist eine umstrittene Pflanze. Für die einen gefährlicher Genussrausch und gefürchtete Abstiegsdroge in die Kriminalität, für die anderen eine Schamenenpflanze für die Reise in die unsichtbare, innere Welt.
Hanf ist eine der vielseitigsten Pflanzen und prägte bereits in der Antike Ansehen und Wohlstand vieler Völker, lieferte Material für Seile, Netze, Stoffe und Papier. Er wurde bei Geburtsschmerzen verwendet und Hildegard von Bingen empfahl die Anwendung von Hanf z.B. bei Migräne. In Russland galt eine Inhalation von Hanfsamen als wirksames Mittel gegen Zahnschmerzen und das Einreiben mit dem Samenöl als wirksam bei Gicht- und Rheumaschmerzen.
Man unterscheidet das wirksame Haschisch- (das Harz der Hanfpflanze) vom Marihuana- (die zerkleinerten, weiblichen Blüten der Hanfpflanze). Das THC ist vor allem im indischen Hanf (Cannabis indica) enthalten, die weitgehend THC freien Sorten (Cannabis sativa und Züchtungen) dürfen von einigen Hanfbauern angebaut werden.
Inhaltsstoffe: THC, ätherische Öle, Zucker, Flavanoide, Alkaloide sowie Chlorophyll.
Wirkungen und Indikationen
Er ist angstlösend, antidepressiv, euphorisierend, stimulierend, schmerzlindernd, muskelentspannend, bronchienerweiternd und stimmungsaufhellend. Wissenschaftliche Studien haben eindeutig bewiesen, dass der Hanf eindeutig als bestens verträgliches und wirkungsvolles Mittel zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen gilt, man konnte auch die schmerzlindernden und krampfstillenden Eigenschaften bei Muskelanspannungen und Kopfschmerzen nachweisen. Hanf als Medizin führt zu einer deutlichen Senkung des Augeninnendrucks (bei Glaukom) sowie zu einer wohltuenden Steigerung des Appetits und Stimmung bei schweren Erkrankungen.
Darreichungsformen:
Präparate fallen unter das Betäubungsmittel Gesetz. Selbstanbau und Zubereitung verboten.
Hanfsamen (THC frei) und Hanföl kann man kaufen, z.B. von der Ölmühle Fandler.
Nebenwirkungen
Gelegentlich Unruhe, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Appetitstörungen. In hohen Dosen wirkt das THC auf die Gedächtnisleistung und verursacht unkoordinierte Bewegungsabläufe und eingeschränkte Reaktionen, außerdem Blutdruckabfall und Herzklopfen.
Hanf hat von allen Pflanzen den höchsten Gehalt an lebensnotwendigen (essenziellen) Fettsäuren. Die kleinen Hanfnüsschen (THC frei), aus denen auch das Öl gepresst wird fördern den Aufbau von Immunglobulinen im menschlichen Körper. Menschen mit einer Störung des Fettstoffwechsels könnten ihre Beschwerden durch nur 10 g Hanfsamen pro Tag entscheidend bessern.
Hanföl ist auch ein gutes Mittel zur Pflege hässlicher Narben, aber auch ein Hautöl bei Neurodermitis oder anderen entzündlichen Hauterkrankungen. Es enthält die Vitamine B und E, hochwertiges Eiweiß mit allen 8! essenziellen Aminosäuren und Gamma Linolensäure.
Die Hanffasern werden schon seit Jahrtausenden zur Herstellung von Textilien und Papier verwendet. Den Höhepunkt der Nutzung erfuhren Hanffasern im 17. Jahrhundert, wo sie vor allem zur Produktion von Seilen und Segeltuch für die Schifffahrt verwendet wurden; für ein normales Segelschiff wurden viele Tonnen Hanffasern benötigt und die Materialien wurden durchschnittlich alle zwei Jahre ersetzt. Hanflangfasern finden heute fast ausschließlich Verwendung bei der Produktion von Textilien. Sie sind sehr reißfest und eignen sich besonders gut für die Bekleidungsindustrie. Dabei erzielen Hanftextilien bessere Werte für Scheuerfestigkeit als Baumwolltextilien und haben daher auch eine längere Lebensdauer.