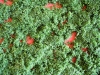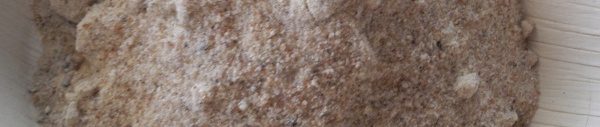Goldrute
Die Goldrute aus der Familie der Korbblütler wächst in lichten Wäldern, auf trockenen Hügeln und auf Heiden. Sie ist die „Nierenpflanze“ und wird auch in alten Büchern erwähnt, sie ist harntreibend und hat auch eine antibakterielle Wirkung. Auch die Kanadische Goldrute und die Riesengoldrute haben eine durchspülende Wirkung und können als Heilpflanzen hergenommen werden. Sie unterscheiden sich allerdings in ihrem Wirkstoffgehalt qualitativ und quantitativ von der einheimischen Goldrute. Alle Arten wirken harntreibend und krampflösend, die einheimische Goldrute zusätzlich noch entzündungshemmend.
Verwendete Teile
Verwendet wird das blühende Kraut mit weniger als 20 % Stängelanteil, weil die hauptwirksamen Flavanoide vor allem in den Blütenköpfchen und in den Blättern vorkommen.
Inhaltsstoffe
1-3 % Flavanoide, Saponine, ätherische Öle, Gerbstoffe, Mineralstoffe, Glykoside
Wirkung/Indikationen
Die Goldrute bewirkt eine direkte Leistungssteigerund der Nieren, wirkt flüssigkeitsausschwemmend, entzündungshemmend und krampflösend an der glatten Muskulatur, schmerzlindernd, steintreibend, antibakteriell und immunmodulatorisch. Die Saponine zeigen auch eine deutlich ödemhemmende Eigenschaft, unterstützt wird die harntreibende Wirkung noch durch die Mineralstoffe. Verwendet wird sie zur Durchspülung der Nieren, Vorbeugung bei entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege, Reizblase, Krämpfen im Urogenitalbereich, Harnsteine und Nierengrieß. Außerdem als Begleittherapie bei rheumatischen Erkrankungen.
Anwendungsformen und Tagesdosis
Als Tee: 1 TL (3 g) mit 150 ml heißem Wasser überbrühen, zugedeckt 20 Minuten ziehen lassen (um Flavanoide zu lösen), abseihen und 2-4 x tgl. 1 Tasse zwischen den Mahlzeiten trinken.
Als Tinktur: selber angesetzt in 35 % Alkohol oder Soldidagoren N Tropfen
Tagesdosis: 6-12 Droge, auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten.
Hinweise
Nicht bei Ödemen infolge eingeschränkter Herz- oder Nierentätigkeit oder chronischer Nephritis, weil dann die Nieren nicht mehr leistungsfähig sind.