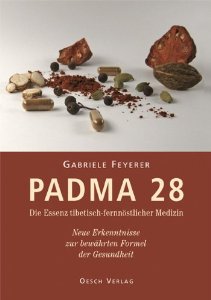Bitterstoffe
Der Volksmedizin ist schon seit langem bekannt, dass der Körper durch das Trinken eines bitteren Getränks gekräftigt wird. Im Altertum wurde bei der Behandlung verschiedenster Beschwerden größter Wert auf Bitterkeit gelegt. Bitterstoffe sind der Hauptbestandteil vieler alter Lebenselixiere, aus denen sich der heute gebräuchliche Schwedenbitter entwickelt hat. Bitterstoffe werden häufig als Gewürze mit der Nahrung aufgenommen, entfalten dort ihre Wirkung als Tonika (Kräftigungsmittel) und sind damit bereits Arzneimittel. Von 1000 Arzneigemischen in der Pflanzenheilkunde sind etwa 1/3 Amaragemische, ob in Form von Würze (Ingwer), als Aperitif (Artischocke) oder als Bier.
Im Pflanzenbereich dienen Bitterstoffe als Fraßschutz. In Wurzeln sind sie gehäuft zu finden, aber auch in Fruchtschalen und Blättern. Viele Pflanzen enthalten Bitterstoffe, es werden aber nur solche zu den Bitterstoffdrogen gerechnet, bei denen die Bitterwirkung im Vordergrund steht. Die anderen Inhaltsstoffe treten zugunsten der Bitterstoffe zurück.
Bitterstoffe sind in ihrer chemischen Struktur nicht einheitlich aufgebaut, einziger Leitfaden dieser chemisch uneinheitlichen Stoffgruppe ist der bittere Geschmack. Sie werden unterteilt in:
-
terpenoide (Mono-, Sequi-, Di- und Triterpene) und
-
nicht terpenoide Bitterstoffe.
Die meisten Bitterstoffe gehören zu den Monoterpenen (Aucubin im Spitzwegerich) und den Sesquiterpenen (Cnicin in der Artischocke). Nicht terpenoide Bitterstoffe können Flavanoide (Naringin in der Orange) oder Zucker (Gentianose im Enzian) sein. Die terpenoiden Bitterstoffe können auf Grund der ähnlichen chemischen Struktur als „größere, wasserlösliche Geschwister „ der ätherischen Öle gesehen werden. Vor allem unter den Korbblütlern und den Doldenblütlern gibt es viele Vertreter, die beide Inhaltsstoffgruppen haben.
Bitterwert
Der Bitterwert wird in Zahlen angegeben. Ein Wert von 10 000 bedeutet z.B. dass ein Extrakt von 1g Droge in 10 000 ml Wasser gerade noch bitter schmeckt. Enzian hat z.B. einen Wert von 10 000, Wermut 10 000-20 000, Schafgarbe 3 000, Löwenzahn 100. Bei falscher Zubereitung (längeres Kochen) und falsch Lagerung der Drogen kann der Gehalt an Bitterstoffen abnehmen.
Unterscheidung der Bittermittel in
-
Amara tonica, die allgemein tonisierende Bitterwirkung steht im Vordergrund. Pflanzen: Enzian, Tausendgüldenkraut, Artischocke, Löwenzahn
-
Amara aromatica, solche mit ätherischen Ölen. Die allgemein tonisierende Wirkung tritt zugunsten der lokalen Magenwirkung in den Hintergrund. Pflanzen mit ätherischen Ölen bewirken meist eine leichte Schleimhautreizung und damit eine verbesserte Durchblutung im oberen Verdauungstrakt. Dadurch kommt es zu einer schnelleren Resorption von Gasen und einen erleichterten Abgang von Darmgasen. Pflanzen: Wermut, Engelwurz, Schafgarbe, Pomeranze.
-
Amara acria, Bitterstoffe mit Scharfstoffen haben einen feurigen Geschmack, regen die Verdauungssekrete und Darmperistaltik an, wirken keimtötend und blähungswidrig. Pflanzen: Ingwer, Galgant, Gelbwurz.
-
Amara mucilaginosa, diese Amara sind bitter und schleimhaltig. Sie fördern die Bindung von Magensäure und schleimhautreizenden Zersetzungsprodukten; ihr Schleim bietet Schutz für entzündete Magenschleimhäute. Pflanzen: Isländisch Moos.
Wirkungen der Heilpflanzen mit Bitterstoffen:
Bitter ist die stärkste Geschmacksqualität, die wir kennen. Die Bitterstoffwirkung beginnt im Mund bei den Geschmacksnerven am Zungengrund.
Die Reaktionen des Körpers auf Bitterstoffe sind sehr individuell und hängen von der jeweiligen Speichelzusammensetzung, vom Alter, der Psyche, dem Gesundheitszustand, Temperament und anderen Faktoren ab. Kinder haben noch mehr Geschmacksknospen und reagieren daher empfindlicher. Bitterstoffe regen auf direktem und reflektorischem Weg die Verdauung an. Häufig können Bitterstoffe auch die Wirkung anderer Stoffe durch eine verbesserte Resorption von Nährstoffen günstig beeinflussen.
-
Wesentliche Voraussetzung für die Bitterstoffwirkung bei Appetitlosigkeit ist die Einnahme ca. ½ Stunde vor dem Essen, bei Verdauungsstörungen ½ Stunde nach dem Essen.
-
Bitterstoffe sind hitzeempfindlich, deshalb nur überbrühen, nicht länger kochen. Kalte Zubereitungen sind bitterer und wirksamer.
-
Die Bitterwirkung beginnt im Mund, also nicht süßen (außer Süßholz: das macht das Bittere angenehm) und erst einmal 1-2 Min. im Mund behalten.
-
Bittermischungen sollten immer wieder geändert werden, um eine Gewöhnung zu verhindern.
-
Bitterstoffe wirken dosisabhängig, mehr ist nicht unbedingt besser.
Magen und Darm, sie wirken:
-
Sekretionsfördernd, appetitanregend, resorptionsfördernd.
-
Peristaltikanregend und die Magenentleerung beschleunigend.
-
Gastrinfreisetzend
-
Blähungs-, gärungs- und fäulniswidrig
-
pH Wert optimierend- für eine verbesserte Funktion der Verdauungsenzymatik.
Sie werden angewendet bei:
Appetitlosigkeit, Verdauungsbeschwerden mit Völlegefühl und Blähungen, Übelkeit, Erbrechen, Verdauungssaftmangel, Magenbeschwerden durch Magenschwäche, Darmsanierung, Obstipation und zur unterstützenden Behandlung bei Eingeweidewürmern.
Resorptionsförderung
Bitterstoffe verstärken die Durchblutung im Verdauungstrakt, die Verdauungsschleimhäute schwellen an und füllen sich mit Lymphe. Das führt zu einer verbesserten Verdauung, einer ver- besserten Resorption der Nahrungsbestandteile und zu einer verbesserten Nahrungsausnutzung: Nährstoffe, fettlösliche Vitamine und Eisen werden besser resorbiert. Auch Aminosäuren werden besser aufgenommen, was zur Folge hat, dass Blähungen und Verdauungsstörungen weniger auftreten. Die Durchwärmung fördert die Stoffwechselaktivität und regt den Appetit an. Die Folge ist eine allgemeine Tonisierung und Kräftigung.
Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse
Bitterstoffe sind Leber- und gallefunktionsfördernd. Auch die Sekretion der Bauchspeicheldrüse wird angeregt und fördert dadurch die Verdauung von Eiweiß, Kohlehydraten und Fetten.
Immunsystem und Blutbildung
Bitterstoffe wirken immunstimulierend und werden daher auch bei banalen Infekten eingesetzt (Enzian, Ingwer). Durch die Anregung der Schweißdrüsen wirken sie auch fiebersenkend und leiten Wärme nach außen ab (Chinarinde, Fieberklee).
Stärkung des Herzens und des Gesamtstoffwechsels.
Bitterstoffe erhöhen die Kontraktionskraft des Herzens. Die Herzkraft nimmt zu, die Kapillaren werden erweitert und der Gefäßtonus erhöht. Blut und Wärme werden im Körper besser verteilt und die Herzkranzgefäße werden besser versorgt (Schafgarbe, Weißdorn), die Schlagfrequenz des Herzens nimmt ab. Bitterstoffe tonisieren, d.h. sie steigern den Tonus der glatten Muskulatur, was sich letztendlich auch auf die Psyche auswirkt.
Sie werden daher auch bei Stimmungsschwankungen, im Alter, bei Antriebsschwäche und beim Erschöpfungssyndrom angewandt. Bitterstoffe machen „warm ums Herz“ und eignen sich für Menschen, die ihre Spannkraft verloren haben, die lethargisch und antriebslos dem Leben gegenüber sind und kein Interesse an der Gegenwart haben. Sie gelten als „Mutmacher“, die helfen können, Depressionen zu mildern und bei Entscheidungsschwierigkeiten zu Klarheit und Standfestigkeit zu kommen.
Nebenwirkungen und Kontraindikationen
Bei zu hohen Dosen können gegenteilige Effekte wie Sekretions- oder Appetithemmung auftreten, Übelkeit und Brechreiz; gelegentlich kommt es auch zu Kopfschmerzen. Vor allem bei zu viel Magensäure, Magengeschwüren und Gallensteinen sollten sie nicht genommen werden.
Pflanzen mit Bitterstoffen
-
–Enziangewächse– bitterste Gruppe. Gelber Enzian, Tausengüldenkraut
-
–Korbblütler– Artischocke, Beifuss, Benediktenkraut, Endivie, Löwenzahn, Mariendistel, Schafgarbe, Wegwarte, Wermut
-
-Pflanzen aus verschiedenen Familien- Andorn, weißer, Bitterklee, Chinarindenbaum, Eberesche, Engelwurz, echte; Galgant, Gamander, Edel, Hanf, Herzgespann, Hopfen, Ingwer, Isländisch Moos, Kalmus, Orange, Pomeranze, Teufelskralle, Weißdorn.